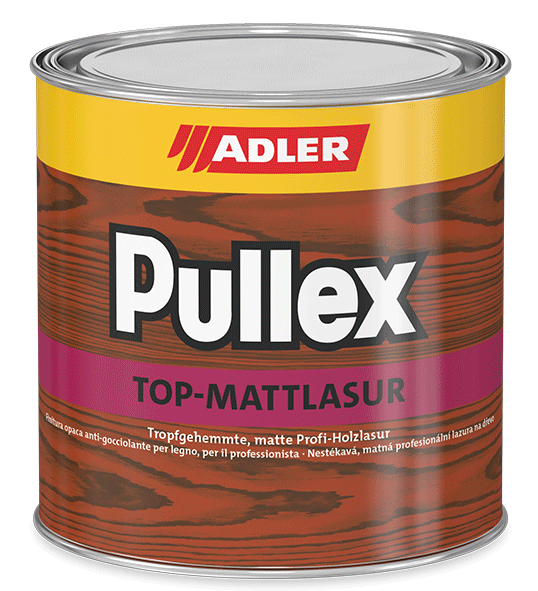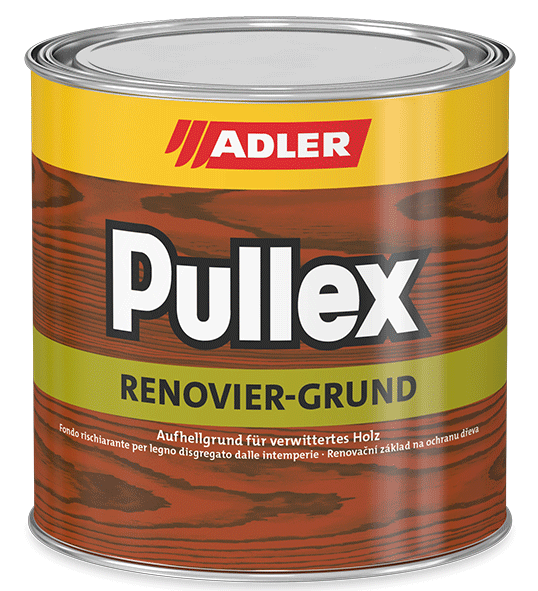Chemischer Holzschutz
Als chemischer Holzschutz wird die Behandlung eines Holzes mit verschiedenen chemischen Mitteln bezeichnet, um das Material vor der Schädigung durch Insekten, Pilzen oder Schimmel zu bewahren. Um den baulichen Holzschutz zu unterstützen, wird chemischer Holzschutz immer vorbeugend eingesetzt, um ein späteres Eingreifen möglichst zu verhindern.

Welche Gebrauchsklassen gibt es?
Holzbauteile werden je nach Verbauungsart in 5 verschiedene Gebrauchsklassen eingeteilt. Die Klassen 0 bis 4 sind in der DIN 68800-3 eingetragen und enthalten Informationen über die Holzschutzmaßnahmen, sowie die erforderlichen Prüfprädikate für den chemischen Holzschutz und erforderliche Menge der Holzschutzmittel für den jeweiligen Zweck.
Wann sollte chemischer Holzschutz eingesetzt werden?
Chemischer Holzschutz enthält nach dem heutigen Kenntnisstand immer noch einen großen Anteil an gesundheitsgefährdenden Bioziden. Der Einsatz sollte aus diesem Grund nur dort erfolgen, wo er zwingend erforderlich ist und wo es auf eine lange Lebensdauer des Materials ankommt. Es muss jederzeit überprüft werden, ob die Notwendigkeit für einen Schutz gegen Insekten und Pilzbefall gegeben ist. Sind entsprechende Beanspruchungen vorhanden, muss ein chemischer Holzschutz erfolgen.
Die umweltfreundlichste Variante, das Holz durch chemische Verfahren vorbeugend zu schützen, gilt die Behandlung mit den sogenannten Salzen aus der Borate Gruppe. Oftmals sind es tragende Bauteile und Holzkonstruktionen, die durch die Bauaufsicht als zu behandeln gekennzeichnet werden. Hier muss ein vorbeugender chemischer Holzschutz erfolgen.
Grundsätzlich sollte man sich vor dem Einsatz von chemischem Holzschutzmittel überlegen, ob ein physikalischer Holzschutz bzw. ein baulicher Holzschutz Und die Behandlung mit Holzschutzlasur und Co. nicht sinnvoller bzw. umweltverträglicher wäre.
Natürlich spielt auch die vorliegende Gebrauchsklasse eine Rolle. Kommt man um den Einsatz von chemischen Holzschutzmaßnahmen nicht herum, um die Dauerhaftigkeit des Baustoffes zu erhalten, können die unterschiedlichen Verfahren zum Einsatz kommen. Der Holzschutz auf der Basis chemischer Mittel findet grundsätzlich nur in Außenbereichen seinen Einsatz. Mögliche Einsatzgebiete sind:
- Fassaden
- Carports
- Dachunterstände
- Balkone usw.
Das Rohholz, sowie das stark verwitterte Holz muss auf jeden Fall mit einer Holzschutzgrundierung behandelt werden, um es vor Bläue und Fäulnis zu bewahren. Im Anschluss kann man beispielsweise 2 Anstriche mit einer Lasur vornehmen. Eine Dünnschichtlasur eignet sich wie oben genannt für die oberflächliche Behandlung. Teilweise gibt es Lasuren, die bereits alles in einem Produkt beinhalten, zum Beispiel Mittel gegen Bläue, Fäulnis und Insekten.
Das Rohholz, sowie das stark verwitterte Holz muss auf jeden Fall mit einem Holzschutzgrund behandelt werden, um es vor Bläue und Fäulnis zu bewahren. Im Anschluss kann man beispielsweise 2 Anstriche mit einer Lasur vornehmen. Eine Dünnschichtlasur eignet sich wie oben genannt für die oberflächliche Behandlung. Teilweise gibt es Lasuren, die bereits alles in einem Produkt beinhalten, zum Beispiel Mittel gegen Bläue, Fäulnis und Insekten.

Bestandteile und Auftragsarten
Chemische Holzschutzmittel werden hauptsächlich aus wasserlöslichen Salzen, sowie ölhaltigen Mitteln hergestellt. Öl-Salz- Gemische kommen hier zum Einsatz, ebenso wie Emulsionen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sie aufzubringen:
- Streichen
- Tauchen
- Fluten
- Spritzen
- Vakumat
- Bürstmaschine
Ist eine bestimmte Einbringtiefe erforderlich, müssen weitere technische Verfahren eingebracht werden, die in der DIN 68800 enthalten und erklärt sind. Dort befinden sich auch Angaben zur Wirksamkeit der Mittel, sowie verschiedenen Wegen, eine Rand-, Tiefen- oder Vollschutz zu erreichen.
Die Hölzer für einen Dachaufbau werden nahezu immer getränkt. Der Baustoff wird dabei in eine Salzimprägnierung gegeben. Sobald die Hölzer auf der Baustelle verwendet werden, müssen sie vor der Auswaschung durch Niederschläge geschützt werden. Ergeben sich durch die Verwendung freie Schnittstellen, so sollten diese auf jeden Fall nachträglich imprägniert werden. Hölzer, die mit einer schaumbildenden Imprägnierung gegen Feuer geschützt sind, benötigen eine spezielle Behandlung. Sämtliche chemische Holzschutzmittel müssen grundsätzlich vor der Verwendung durch das Institut für Bautechnik zugelassen werden. Danach erfolgt eine Kennzeichnung, die dem Anwender Hinweise zur Verarbeitung bieten.

Aktive und passive Maßnahmen
Zusätzlich zum Anwendungsgebiet, muss man beim chemischen Holzschutz auch noch unterscheiden, ob es sich um vorbeugende oder bekämpfende Maßnahmen handelt. Bei den vorbeugenden Maßnahmen will man das Material erst gar nicht mit Schädlingen oder anderen äußeren Einflüssen in Berührung kommen lassen. Es gilt also, das Holz für Schädlinge unattraktiv zu gestalten. Schadorganismen sollen sich nicht mehr für das Holz, welches man als Baustoff verwendet hat, interessieren. Es gibt verschiedene Arten des Schutzes, der von der Intensität der Behandlung abhängig ist.
- Oberflächenschutz: Macht das Eindringen der Holzschutzmittel unerforderlich. Es reicht also eine rein oberflächliche Behandlung des Materials. Das Mittel kann entweder aufgestrichen oder aufgespritzt werden.
- Randschutz: Das Mittel wird wenige Millimeter unter die Oberfläche dringen. Es kann sowohl durch Tränken, Fluten oder über das Sprühtunnelverfahren aufgetragen werden.
- Tiefenschutz: Das Holzschutzmittel dringt mehrere Millimeter bis Zentimeter in das Holz ein.
Dies wird über das Kesseldurckverfahren bzw. das Heiß-Kalt Einstelltränkverfahren erzielt. Die Standzeit der jeweiligen Holzprodukte, also die Lebensdauer und die Dauerhaftigkeit, wird in erster Linie über die Stärke des Schutzmantels bestimmt. Folgende Sinnkette kann angewendet werden: Besser Randschutz, als Oberflächenschutz; besser Tiefenschutz, als Randschutz.

Gebrauchsklassen
Verbautes Holz ist in unterschiedlichem Maße dem Angriff durch Pilze und/oder Insekten ausgesetzt. Mit Gebrauchsklassen werden einzelne Holzbauteile in ihrer verbauten Situation bewertet, um Art und Umfang eventuell notwendiger chemischer Holzschutzmaßnahmen zu beurteilen. Folgende Gebrauchsklassen sind möglich:
| Gebrauchsklasse | Allgemeine Gebrauchsbedingungen | Feuchtigkeit | vorkommende Organismen | erforderlicher Holzschutz |
|
0 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|

Gebrauchsklasse 1+2 Schutz vor Insekten (vorbeugend) notwendig
Sind Hölzer durch Insekten gefährdet, wird innerhalb dieser Thematik noch einmal in drei verschiedene Insektenarten unterschieden:
- Frischholz Insekten
- Faulholz Insekten
- Trockenholz Insekten
Gebrauchsklasse 3+4 Vorbeugender Schutz vor Insekten, Pilzen und Auswaschung
Bei den Techniken zur Aufbringung bzw. Anbringung der Holzschutzmittel auf bzw. in das Holz, gibt es im Außenbereich zwei verschiedene Gefährdungsklassen, nämlich 3 und 4. Für diese sind nach DIN 68800-3 zwei Verfahrensgruppen bedeutsam:
- Das DIY Verfahren (Do it yourself)
- Das großtechnische Verfahren (Kesseldruck. usw)
Auch bei den Kesseldruckverfahren kann man wieder in verschiedene Techniken unterscheiden. Die Imprägnierung von Holz-Baustoffen für den Garten und Landschaftsbau, sowie für den Spielplatzbau kann über folgende Verfahren erfolgen: Volltränkung Wechseldrucktränkung Die Schutzbehandlung von Holz mit dem Kesseldruckverfahren ist immer dann zwingend erforderlich, wenn die Hölzer für die Verwendung im Außenbereich vorgesehen sind, also wenn es um den Bau von Garten- und Landschaftsanlagen, sowie um Spielplätze geht. Dies schreibt die DIN 68800-3 vor, da sich das Holz dann in der Gefährdungsklasse 4 befindet. Das bedeutet, dass ein dauerhafter Kontakt des Holzes mit der Erde und eine ständige Befeuchtung gegeben sind.
Das Kesseldruckverfahren wird ansonsten überwiegend dann angewendet, wenn die Hölzer sich in der Gefährdungsklasse 3 befinden. Hier sind alle Baustoffe aus Holz enthalten, die einer ständigen Witterung und somit auch Kondensation, aber nicht einem ständigen Erdkontakt ausgesetzt sind. Immer öfter werden auch Hölzer der Klasse 2 behandelt. Diese sind nicht durchgehend der Witterung oder einem dauerndem Kontakt mit der Erde ausgesetzt. Um einen optimalen Schutz des Holzes zu gewährleisten, müssen beim Kesseldurckverfahren alle Parameter exakt eingehalten werden, da diese die Mindestlösungskonzentration, sowie die Mindesteindringtiefe beeinflussen.
Durch chemische Holzschutzmaßnahmen ist man in der Lage, die Substanz der Hölzer im Außenbereich für einen sehr langen Zeitraum aufrecht zu halten, was zur Sicherheit und zur Stabilität einer Konstruktion beiträgt. Chemischer Holzschutz sollte trotzdem nur dann eingesetzt werden, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, das Holz zu schützen.

Was ist chemischer Holzschutz?
Holzschutzmittel wirken gegen Schadorganismen wie Bläuepilze, holzzerstörende Pilze oder gegen Schadinsekten wie Holzwürmer oder Termiten.